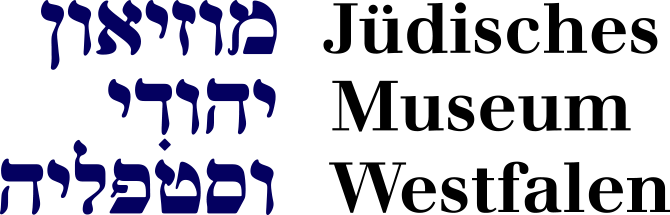25 Jun „Ostjuden-Gefahr!“ Wie Dorstens Synagogengemeinde
einmal kurz berühmt-berüchtigt wurde
„Ostjuden-Gefahr!“ Wie Dorstens Synagogengemeinde einmal kurz berühmt-berüchtigt wurde
von Norbert Reichling, Vorstand Trägerverein
Dass Migrationsprozesse gesellschaftliche Konflikte um Macht und andere Ressourcen verschärfen können, wissen wir nicht erst seit den Veröffentlichungen von Aladin El-Mafaalani, Naika Foroutan und Thilo Sarrazin (Pardon für die Aufzählung an die ersten beiden!). Auch Minderheiten grenzen sich mitunter scharf voneinander ab im Kampf um die Anerkennung der Mehrheitsgesellschaft. Und in den sich rapide erweiternden jüdischen Gemeinden der 1990er Jahre wurde ebenfalls mit harten Bandagen gekämpft, auch schon mal von „Klein-Moskau in Bochum“ geraunt angesichts der ungewohnten Diskussionen und Mehrheiten.
Dass es solche Konflikte innerhalb der jüdischen Community Deutschland schon einmal Anfang des 20. Jahrhunderts gab, ist wenig bekannt. Die sogenannten „Ostjuden“ – eingewandert seit Ende des 19. Jahrhunderts vor allem aus „Russisch-Polen“, verstärkt seit 1914 – stellten in manchen Städten und Regionen, etwa im Ruhrgebiet, eine große Minderheit dar, die in den Gemeinden vielfach Ängste auslöste. Diese Juden und Jüdinnen flohen vor staatlicher Willkür und Pogromen, und im Ersten Weltkrieg organisierte das Deutsche Reich wegen des Arbeitskräftemangels staatliche Anwerbeaktionen. Von 1890 bis 1914 emigrierte mehr als zwei Millionen Juden und Jüdinnen aus dem russischen Reich, die meisten von ihnen in die USA. Zwischen 1914 und 1921 kamen etwa 100.000 Ostjuden nach Deutschland, von denen allerdings 1921 schon 40 % weiter in ihr eigentliches Auswanderungsland (wiederum oftmals die USA) gereist waren. Im industriell geprägten Ruhrgebiet lebten besonders viele dieser osteuropäischen Juden; 1918 waren dies ca. 16.000, darunter etwa 4.000 im Bergbau Tätige. Ihre rechtliche und staatliche Diskriminierung war an der Tagesordnung.
Der Begriff der „Ostjuden“ hat schillernde Bedeutungen und wurde auch als abwertend verstanden (weshalb es auch eine Verirrung ist, ihn auf die nach 1990 Eingewanderten anzuwenden). Das hochakkulturierte deutsch-jüdische Bürgertum sah seine eigene Anerkennung durch diese in Kleidung und Kultus exotisch erscheinenden Gestalten gefährdet und war durchaus geneigt, klassische antisemitische Stereotype gegen die sozial, religiös und kulturell verschiedenen „Brüder und Schwestern“ zu mobilisieren. Ein Beispiel? „Die Betgemeinschaft der Ostjuden ist eine besondere Gemeinschaft und als polnische, gegen das Deutschtum gerichtete Gruppe zu betrachten.“(so ein Gemeindevorstandsmitglied aus Herne) Zugleich aber wurde hier und da in die Ostjuden und ihre angebliche „tiefe Religiosität“ – etwa von Intellektuellen wie Martin Buber und Gershom Scholem, aber von einzelnen Rabbinern der Region wie Benno Jacob – ein Erneuerungspotenzial für das „erschlaffte“ jüdische Leben im Westen hineingelesen.
„Ausländer“ in der Oberhand?
Was hat dies alles mit Dorsten zu tun? Seit dem 19. Jahrhundert und bis 1932 war hier eine „Synagogenhauptgemeinde“ mit regionaler Bedeutung angesiedelt; sie umschloss Teilgemeinden in den heutigen Städten Gladbeck, Herten, Gelsenkirchen, Bottrop, Marl, Schermbeck und Oberhausen (und hatte in den Weimarer Jahren mit den Strukturveränderungen des Ruhrgebiets längst ihre frühere Bedeutung verloren, was 1932 zur Auflösung dieses Verbunds führte). Das hinderte sie aber nicht, in den Jahren 1925 bis 1927 zum Thema eines reichsweit beachteten Skandals zu werden.
In der Dorstener Hauptgemeinde machte der Vorstand 1925, nach der Etablierung einer unerwünschten Mehrheit im Landesverband, den ungeschminkten Versuch, den „Ausländern“ alle Stimmrechte in der Gemeinde zu nehmen, „da das preußische Judengesetz nur Preußen, keine Ausländer kenne, und diese deshalb überhaupt keine Gemeindemitglieder seien.“ Ausgerechnet zum Schabbatbeginn berief man im Mai 1925 ein Treffen der Gemeindevertretung ein; die Bitte des einzigen orthodoxen (und ostjüdischen) Gremienmitglieds um eine Verschiebung wurde abgelehnt, „und ohne viel Federlesens wurde der Rechtsraub vollzogen“. In mehreren Folgebeschlüssen der Jahre 1925 und 1926 wurde die völlige Streichung des aktiven und passiven Gemeindewahlrechts der „Ausländer“ bekräftigt. Und das war nicht der erste Versuch in dieser Richtung: nach den Berichten der Jüdischen Rundschau waren schon 1924 in Dorsten ostjüdische Kandidaten willkürlich von der Wahlliste gestrichen worden, bis der Regierungspräsident korrigierend eingriff.

Die zionistische „Jüdische Rundschau“ (damals eine seriöse Zeitung) berichtete am 12. Oktober 1926 unter dem Titel „Entartung“ aus der Synagogenhauptgemeinde Dorsten (siehe nebenstehenden Ausschnitt) und machte aus ihrer Stellung zum angesprochenen Konflikt kein Geheimnis: Das Blatt verwies auf die Bedeutung der steten Zuwanderung aus dem Osten für die jüdische Gemeinschaft in Deutschland und betonte, dass eine rechtliche Unterscheidung zwischen in- und ausländischen Juden sowohl seitens des Staates als auch in der jüdischen Gemeinschaft absolut unüblich sei. Einzelne Gemeinden, die dem entgegenhandelten, hätten dies bisher meistens schamhaft versteckt, nachdem man öffentlich, etwa bei den Sitzungen des Preußischen Landesverbands, für eine Gleichbehandlung gestimmt habe.
Auch der Oberpräsident der Provinz Westfalen verweigerte den neuen Gemeinde-Regelungen seine Genehmigung. Die Dorstener Gemeindevertretung wiederholte ihren Beschluss und wandte sich direkt an den preußischen Kultusminister mit der Bitte um Zustimmung. Eine Delegation wurde bestimmt, um nach Berlin zu reisen. „Der nach Westfalen ausgewanderte Vorsteher der Gemeinde wollte die Führung wohl deshalb übernehmen, weil er aus seiner masurischen, einen Steinwurf von der polnischen Grenze entfernten Heimat die polnischen Juden am besten beurteilen konnte.“ (Jüdische Rundschau) Doch gab es im Berliner Ministerium keinen Termin. Als sich die Angelegenheit peinlich hinzog, beschloss der Dorstener Gemeinde-Vorstand, die benachbarten Gemeinden des Ruhrgebiets um Beistand wegen der angestrebten Statutenänderungen zu bitten, und versandte diesen Appell.
Süffisant merkte die Jüdische Rundschau dazu an, dass es im gesamten Industriegebiet an der Ruhr eine einzige Gemeinde mit zwei ostjüdischen Repräsentanten gibt, überall sonst nur ein oder kein Mitglied dieser Gruppe (die vielerorts 40 % der Mitglieder stellte). Und die Hoffnung wird ausgesprochen, dass die hier öffentlich gemachte Blamage die jüdische Öffentlichkeit, die Gemeinden und anderen Organisationen aufrütteln und zu Klarstellungen veranlassen kann.
Politik der Nadelstiche gegen die Minderheit
Doch das dauerte; noch im Frühjahr 1927 folgte der nächste Versuch. Diesmal wurden Wähler gestrichen, die angeblich keine oder nur säumig Steuern bezahlt hätten. „Ein 65jähriger Bergarbeiter, der Altersrente bezieht, ein Greis, der im Hause seines Sohnes sich aufs Altenteil zurückgezogen hat und viele andere arme Leute wurden vom Vorstand ihrer Rechte für verlustig erklärt. (…) Verhältnisse wie hier herrschen in fast allen Gemeinden Westfalens.“ (Jüdische Rundschau vom 22.4.1927) Eine Variante dieses Versuchs war die Einführung von „Karenzzeiten“, d.h. einer mehrjährigen Präsenz, bis man die Gnade des Wahlrechts erlangen sollte – so u.a. die Gemeinden in Dortmund und Wattenscheid. Sonderlich erfolgreich waren diese Strategien offenbar nicht; bei den Gemeindewahlen 1928 erreichte die „liberale“ Liste in Dorsten neun Sitze und die gemäßigt zionistische „Volkspartei“ fünf Sitze. Und der Dorstener Fall war, wie erwähnt, kein extremer Einzelfall…
Nicht verschwiegen sei eine laute und wichtige Gegenstimme (solche gab es auch in vielen jüdischen Verbänden!) : Der Duisburger Rechtsanwalt und Zionist Harry Epstein zum Beispiel kämpfte, obwohl selber aus einer „alteingesessenen“ Familie, schon seit 1903 für die sozialen und politischen Rechte der Ostjuden in der Rhein-Ruhr-Region. In zwei Leitartikeln der Jüdischen Rundschau vom 15. Januar 1926 und vom 30. November 1926 zum Beispiel prangerte er leidenschaftlich die geschilderten Ausgrenzungsversuche als „gelben Fleck der Entrechtung“ an. Die Besitzstände der liberal-national gestimmten „deutschen“ Juden gründeten sich auf das undemokratische Dreiklassenwahlrecht und seien daher unhaltbar. Auch in Aachen, Bochum, Bonn, Crefeld (heute Krefeld), Düsseldorf, Duisburg, Hamborn, Hamm, Lüdenscheid und Recklinghausen könne man dieses ungerechte und unjüdische Verhalten beobachten.
 Harry Epstein (1879-1973)
Harry Epstein (1879-1973)
Epstein scheute sich nicht, die Motive dieser opportunistischen jüdischen Deutschtümelei klar zu benennen: „Je mehr man sich nun der nichtjüdischen Umwelt mit aller Inbrunst anzuähneln bestrebt war, umso hinderlicher erschien alles, was in Haus und Gemeinde an Judentum erinnerte.“
Und ein Lob für den Rechtsstaat fiel dabei auch ab: die preußischen Judengesetze von 1847 seien ein Schutzschild gegen diejenigen, die nun von den „Fremden niederer Kultur“ redeten; er resümiert: „es spricht für den Gerechtigkeitssinn der zu Zeiten doch durchaus reaktionären Behörden, wenn sie schutzlose Juden vor Juden geschützt und der Versuchung widerstanden haben, aus Schauder vor dem furchtbaren Zerrbild, das Juden von Juden entwarfen, vom Wege des Rechts abzuweichen.“
(Juni 2021)