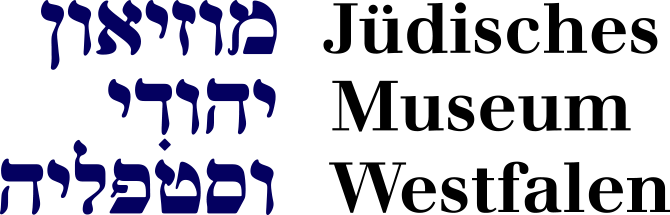29 Nov Postmodern, postnational, postmoralisierend, postkolonial, postheroisch…
Postmodern, postnational, postmoralisierend, postkolonial, postheroisch…
von Dr. Norbert Reichling, Erster Vorsitzender des Trägervereins des JMW
Die „Erinnerungskultur“ in Deutschland, auf die Viele so stolz sind, ist kein fertiger, ausdefinierter Besitzstand, sondern ein nicht abschließbarer Lernprozess. Und das ist gut so.
Die Besucher*innen-Zahlen der deutschen Museen sind (von Corona-Zeiten mal abgesehen) sechsmal so hoch wie die der 1. Bundesliga, aber der schon länger anhaltende Museumsboom geht zugleich einher mit recht grundlegenden Verständigungsdebatten um die Diversität und Repräsentativität der Institutionen, um gesellschaftliche Partizipation und die Stimmigkeit ihrer „Erzählungen“. (Auch das Jüdische Museum Westfalen hat sich im letzten Jahr im Rahmen seines strategischen Nachdenkens ein neues Leitbild gegeben.)
Das ändert aber nichts daran, dass wir uns – wie alle denkenden Zeitgenoss*innen – mit unseren Konzepten der Ausstellung und Vermittlung permanent vielen schwierigen Fragen ausgesetzt sehen. Uns an die Herausforderungen der Postmoderne – wachsende Ungewissheiten, brüchige Weltbilder, mehr Fragen und Dilemmata als eindeutige Thesen – zu gewöhnen, hatten wir ja immerhin etwa zwei bis drei Jahrzehnte Zeit. Auch „Blicke über den Zaun“, in die europäischen Nachbarländer und deren Sichten auf die gemeinsame Geschichte, sind halbwegs selbstverständlich geworden. Und die Diskussion, dass die Vermittlungsarbeit an Erinnerungsorten und in Museen offener werden sollte, weniger mit „erwünschten Lehren“ als mit Fragen und Perspektivenvielfalt arbeiten sollte, ist unter Professionellen ebenfalls schon eine Weile geführt worden, mehr Offenheit als berufsethische Leitlinie weitestgehend akzeptiert; „postmoralisierende Erinnerung“ nennt dies der britische Historiker Bill Niven, „postapodiktisch“ die Autorin Cornelia Siebeck. Wenn da nur nicht die Zuschreibungen von außen, aus Politik, Medien etc. wären, die immer noch an plötzliche Umerziehung und bekehrungsähnliche Vorgänge bei uns und anderswo glauben möchten, könnte es zum Konsens werden, dass die „Lehren der Geschichte“ nicht immer eindeutig sind, dass aber kluge Bildungsarbeit, Wissen und experimentierende Wertediskussionen Junge und Alte befähigen können, sich in ein reflektiertes Verhältnis zur „Vergangenheit“ und ihren Folgen zu setzen.
 Aber nun kommt es knüppeldick: Wir arbeiten nämlich in einer Zeit, in der die deutsche Erinnerungskultur von nicht wenigen postkolonialen Kritiker*innen leichthin als erstarrter „Katechismus“ bewertet und grundsätzlich in Frage gestellt wird. Die langen und umwegigen Lernprozesse der deutschen Öffentlichkeiten hin zur Wahrnehmung der Völkermorde als Zentrum der Naziverbrechen werden nun von Manchen als „Opferhierarchie“ missverstanden, die für die notwendige Wahrnehmung der und Empathie mit anderen Opfern geschichtlicher Großverbrechen, vor allem denen des Kolonialismus, zu wenig Raum lasse. Etwas vorsichtigere Stimmen rufen danach, „den Schmerz der Anderen“ mit in den Blick zu nehmen (s. etwa die Rezension in „Schalom“ Nr. 91, S. 23).
Aber nun kommt es knüppeldick: Wir arbeiten nämlich in einer Zeit, in der die deutsche Erinnerungskultur von nicht wenigen postkolonialen Kritiker*innen leichthin als erstarrter „Katechismus“ bewertet und grundsätzlich in Frage gestellt wird. Die langen und umwegigen Lernprozesse der deutschen Öffentlichkeiten hin zur Wahrnehmung der Völkermorde als Zentrum der Naziverbrechen werden nun von Manchen als „Opferhierarchie“ missverstanden, die für die notwendige Wahrnehmung der und Empathie mit anderen Opfern geschichtlicher Großverbrechen, vor allem denen des Kolonialismus, zu wenig Raum lasse. Etwas vorsichtigere Stimmen rufen danach, „den Schmerz der Anderen“ mit in den Blick zu nehmen (s. etwa die Rezension in „Schalom“ Nr. 91, S. 23).
Ältere Zeitgenoss*innen werden ein Déja-vu haben aus den verqueren Debatten nach 1990, als befürchtet wurde, man könne die Opfer des SED-Regimes und ihr Leiden nicht würdigen, ohne die Opfer der Nazis abzuwerten. Sind wir als geschichtsinteressierte Öffentlichkeit wirklich so beschränkt? Nein – sind wir nicht! Natürlich wirken solche neuen Blickrichtungen zunächst überfordernd; nicht umsonst klagen Geschichtsdidaktiker*innen schon lange, dass ihr „Stoff“ unweigerlich von Tag zu Tag umfangreicher wird.
Eine multiperspektivische oder auch multidirektionale Geschichtskultur ist möglich und sinnvoll, „macht aber viel Arbeit“, um es mit K. Valentin zu formulieren. Es braucht seine Zeit, um Kenntnisse zu erweitern und sachlich-fachlich-öffentlich durchzubuchstabieren, was solche Perspektivwechsel für Kultureinrichtungen und ihre Angebote, aber auch für Gedenktage, schulische Curricula, museale Vermittlungsarbeit, Literaturkanon, Straßennamen usf. bedeuten (und auch die ganz verschiedenen Standards etwa für repräsentative und pädagogische Sphären herauszuarbeiten). Unübersichtlichkeit ist da kein Manko, sondern ein Qualitätsmerkmal: Die Vielzahl der bürgerschaftlichen, medialen, künstlerischen, pädagogischen Stimmen ist nämlich geeignet, die „staatsverstärkte Engherzigkeit“ (Lutz Niethammer) und die drohende Gedenkstolz-Behaglichkeit einer nur politisch definierten Erinnerung wieder und wieder zu korrigieren.
Ist die Assoziation zum nächsten „post“-Stichwort zu kühn? „Postheroische Zeiten“, also die kühle Nüchternheit und Sachlichkeit „normal“ erscheinender Zeiten werden gerade aus Anlass des russischen Kriegs gegen die Ukraine hier und da für beendet erklärt, Helden werden anscheinend wieder gebraucht. Kann das auf uns und unsere Arbeit überschwappen? Ohne die aktuellen militärpolitischen Streitfragen hier auch nur anzutippen: noch ein „Nein“, wir erzählen in Museen, Gedenkstätten, Ausstellungen und anderen Interventionen weiterhin keine Helden- und Schurken-Stories, wir sollten uns die Sachlichkeit und Wissenschaftsorientierung sowie die „Grautöne“ unserer Ausstellungs- und Bildungsarbeit nicht von solchen voreiligen Parolen zerreden lassen, vielmehr auch bei aller Dramatik sich überlagernder Krisen daran festhalten: „die Aufklärung“ (und dazu gehören nun einmal argumentative Gelassenheit, Aufmerksamkeit für Ambivalenzen und Perspektivenvielfalt) ist kein abgeschlossener und abschließbarer Prozess. Der Lernbedarf wäre dann eher, neben den Kontinente überschreitenden Blicken „einfach“ mal ukrainische, lettische, ja auch moldawische, russische, georgische usw. Perspektiven mit wahrzunehmen und soweit möglich auch in die Vermittlungsarbeit hereinzuholen. Von derartigen – manchmal radikalen und überraschenden – Blickerweiterungen hat nämlich die gesamte Gedenkstättenarbeit in ihrer etwa 40-jährigen Geschichte immer wieder gezehrt für ihre erstaunliche Weiterentwicklung.
(Dezember 2022)