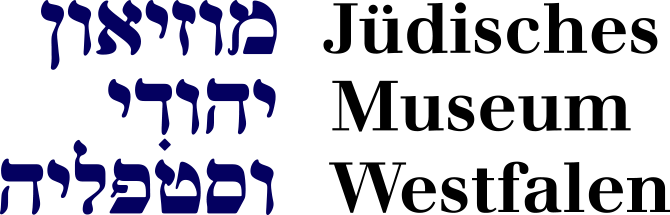06 Nov. Warum ich im Jüdischen Museum arbeite
von Vincenzo Velella, Besucherdienst
Warum ich im Jüdischen Museum arbeite
 Fraglos durchlebten wir in den letzten Monaten merkwürdige, noch nie dagewesene, besorgniserregende Dinge, und das wird gewiss eine Weile so weitergehen. Das kollektive Gedächtnis für die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und psychologischen Umbrüche, für die Verwerfungen, die eine Pandemie, beispielsweise die Spanische Grippe in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg, zeitigten, sind naturgemäß nur noch in Dokumenten, nicht mehr in mündlichen Erzählungen von Überlebenden zu erfahren. Je weiter die Katastrophen zurückliegen, desto weniger scheinen sie uns zu berühren, und desto befremdlicher erscheint es uns bisweilen, wie die Quellen die Ereignisse erfassen und deuten. Sensibilitäten verändern sich mit den Jahrzehnten, völlig neue, anfangs überraschende Aspekte treten in den Fokus, Wahrnehmungsstrukturen des kollektiven Bewusstseins werden durch Großereignisse in Frage gestellt, und mit ihnen, zwangsläufig, durch und mit der Biographie, auch jene des Individuums.
Fraglos durchlebten wir in den letzten Monaten merkwürdige, noch nie dagewesene, besorgniserregende Dinge, und das wird gewiss eine Weile so weitergehen. Das kollektive Gedächtnis für die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und psychologischen Umbrüche, für die Verwerfungen, die eine Pandemie, beispielsweise die Spanische Grippe in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg, zeitigten, sind naturgemäß nur noch in Dokumenten, nicht mehr in mündlichen Erzählungen von Überlebenden zu erfahren. Je weiter die Katastrophen zurückliegen, desto weniger scheinen sie uns zu berühren, und desto befremdlicher erscheint es uns bisweilen, wie die Quellen die Ereignisse erfassen und deuten. Sensibilitäten verändern sich mit den Jahrzehnten, völlig neue, anfangs überraschende Aspekte treten in den Fokus, Wahrnehmungsstrukturen des kollektiven Bewusstseins werden durch Großereignisse in Frage gestellt, und mit ihnen, zwangsläufig, durch und mit der Biographie, auch jene des Individuums.
Diesen Verschiebungen der Wahrnehmungsmuster kommt man am besten auf die Spur, wenn man Kunstwerke betrachtet. Schon die Verhandlung, was überhaupt als Kunstwerk aufgefasst werden soll, führt zu erbittertem Streit – wir erinnern uns an Worte wie Affenmusik, mit denen Eltern in den späten 1960er Jahren die Hörgewohnheiten ihrer Kinder kommentiert haben sollen, und es ist abzusehen, dass das Urteil meiner Generation angesichts der Entwicklungen im Hip-Hop der letzten Jahrzehnte zu analogen Schlüssen kommen wird. Ja, die Kluft zwischen, sagen wir, Vico Torriani und Can ist genauso groß wie die zwischen Can und Fler. Einspruch – Vico Torriani und Can wussten sich wenigstens mit Geschmack zu kleiden. Wie aber werden kommende Zeiten auf uns, die wir, sozusagen als Einwohner der Gegenwart an vorderster Front der Geschichte stehen – wie werden kommende Zeiten auf uns schauen?
Im oberen Stockwerk des Museums, im Teil der Dauerausstellung, die mit ‚von hier‘ überschrieben ist, steht in einer Vitrine ein Electrola-Koffergrammophon von 1929, eine Leihgabe der Familie Joerss. Darauf eine Schellack- (oder Decalith?-) Platte mit dem ‚Lied der Lippischen Schützen‘, vorgetragen von Joseph Plaut (1879-1966). Den Sänger und Rezitator lernte ich erst mit der Eröffnung der überarbeiteten Ausstellung kennen. Mein Eindruck, als ich den Hörknubbel nahm: ein Tonzeugnis aus einer ziemlich fremden Welt traf auf meine Ohren, unwillkürlich stiegen Bilder auf von Filmen, die in meiner Kindheit vermutlich zum allerletzten Mal im Fernsehen ausgestrahlt wurden, Filme aus der Weimarer Zeit, etwa mit Theo Lingen oder dem jungen Hans Albers, einer Zeit, in der die Herren Knickerbocker und Monokel trugen, und die Damen, ganz auf der Höhe der Zeit, sich demonstrativ mit Zigarette fotografieren ließen.
Einher mit den fremden Dresscodes gehen auch andere Strategien, Zweideutigkeiten und Subtexte unterzubringen, die jeder in der Zeit verstehen konnte, die wir Heutige aber leicht übersehen – weshalb hätten sich die Mädchen denn freuen sollen, als die Lippischen Schützen auf dem Weg nach Frankreich – wo es sich doch leben soll wie die Götter – im Dorf Quartier nahmen? Ein anderes von Plaut interpretiertes Marschlied auf YouTube, ‚Detmold-Lippe, eine wunderschöne Stadt‘, gehört übrigens heute noch zur musikalischen Tradition der Bundeswehr. Befremdlich auch die Diktion mit dem gerollten R: sie ist wohl weniger dem Lippischen geschuldet – das kann ich als Ortsfremder schwer einschätzen – als vielmehr einer Zeit, in der Sprache einen gewissen Schneid haben musste. Wenn überhaupt, kennen wir das nur noch aus Wochenschau-Filmen. Oder Schlimmerem.
den fremden Dresscodes gehen auch andere Strategien, Zweideutigkeiten und Subtexte unterzubringen, die jeder in der Zeit verstehen konnte, die wir Heutige aber leicht übersehen – weshalb hätten sich die Mädchen denn freuen sollen, als die Lippischen Schützen auf dem Weg nach Frankreich – wo es sich doch leben soll wie die Götter – im Dorf Quartier nahmen? Ein anderes von Plaut interpretiertes Marschlied auf YouTube, ‚Detmold-Lippe, eine wunderschöne Stadt‘, gehört übrigens heute noch zur musikalischen Tradition der Bundeswehr. Befremdlich auch die Diktion mit dem gerollten R: sie ist wohl weniger dem Lippischen geschuldet – das kann ich als Ortsfremder schwer einschätzen – als vielmehr einer Zeit, in der Sprache einen gewissen Schneid haben musste. Wenn überhaupt, kennen wir das nur noch aus Wochenschau-Filmen. Oder Schlimmerem.
Uvo Hölscher, der 1996 verstorbene Münchener Altphilologe, prägte, die Auseinandersetzung der Moderne mit der Vergangenheit betreffend, das Schlagwort der Chance des Unbehagens. Wo anders hat man in besonderer Weise diese Chance, wenn nicht beim Besuch eines Museums? Oder, wenn man in ihm arbeitet.
(November 2020)
Copyright: NRW-Stiftung, Werner Stapelfeldt